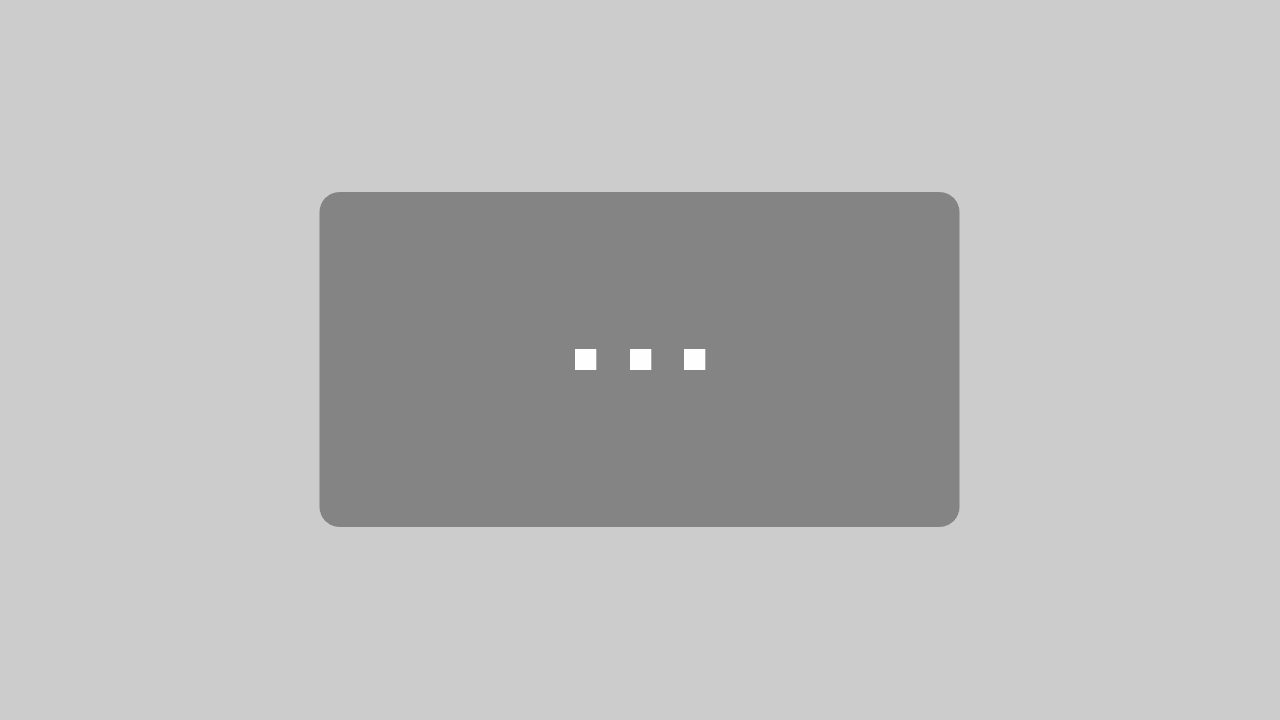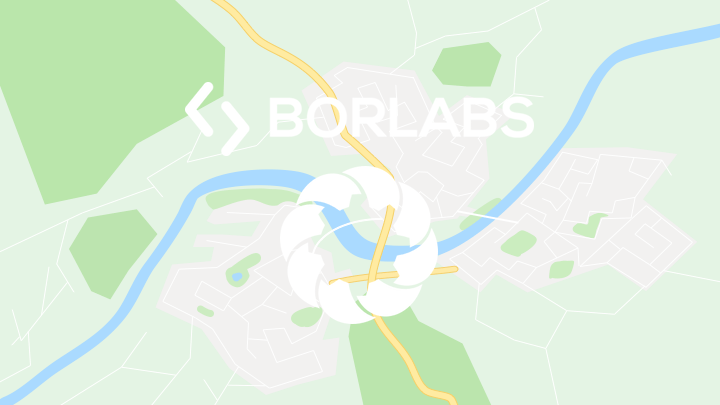Mannheim/Rhein-Neckar, 23. Februar 2015. (red/ms) “Daten sind das neue Öl”, sagt der Open-Data Experte Oliver Rack. Und: “Diese Rohstoffe sollten nicht verschwendet werden.” Öffentliche Verwaltungen erheben Unmengen an Informationen aus den verschiedensten Bereichen: Verkehrsgutachten, Gesundheitsstudien oder Geodaten. Diese Informationen sind zwar vorhanden – oft bleiben sie aber unter Verschluss. Oliver Rack will diese Daten öffentlich zugänglich machen und weltweit miteinander vernetzen.
Von Minh Schredle

Oliver Rack – ein Mann mit klaren Zielen und großen Ambitionen. Foto: privat.
Es wäre schön, wenn Entscheidungen auf der Basis von Informationen und Fakten getroffen werden,
findet Oliver Rack. Das klingt eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit – ist aber in der Realität leider nicht immer der Fall.
Herr Rack ist der Gründer und Chef von Open Data Rhein-Neckar. Dabei handelt es sich um eine Organisation, deren Ziel es ist, sämtliche Datenbestände öffentlich zugänglich zu machen, an denen die Allgemeinheit Interesse haben könnte.
Insbesondere geht es dabei auch um Informationen, die von öffentlichen Verwaltungen erhoben und durch Steuergelder finanziert werden, aber bislang den Bürgern vorenthalten bleiben.
Aufwändige Arbeit – Sponsoren gesucht
Open Data Rhein-Neckar startete Anfang 2013 als Oliver Racks Soloprojekt. Mittlerweile gibt es einige Unterstützer. Dennoch ist der Arbeitsaufwand enorm:
An manchen Tagen arbeite ich von 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr.
Eine goldene Nase verdient er sich damit nicht – im Gegenteil: Das Projekt schreibt rote Zahlen. “Ich finanziere das alles aus meinem Erspartem”, sagt Herr Rack dazu. Es sei dringend notwendig, mehr Sponsoren und Unterstützer zu finden.
In der öffentlichen Wahrnehmung spielt das Thema Open Data bislang kaum eine Rolle. Die Medien berichten eher verhalten. Nur wenige Bürger haben sich umfassend mit dem Thema auseinander gesetzt. Herr Rack sagt dazu:
Ein großes Problem ist, dass die meisten gar keine Ahnung haben, was ihnen hier entgeht. Bei den Verwaltungen schlummern wahre Schätze.
Daten sind das neue Öl – so viel steht für Herrn Rack fest. Geodaten, Bodenwerte, statistische Untersuchungen, wissenschaftliche Gutachten und mehr: All diese Informationen sieht Herr Rack als Rohstoffe an. Sie könnten in Anwendungen und Applikationen genutzt werden, um unseren Alltag zu erleichtern. Daten ließen sich interaktiv visualisieren und ansprechend aufbereiten. Dafür müssen die Informationen aber verfügbar sein. Tatsächlich sind sie zwar in vielen Fällen vorhanden – aber man kommt als “normaler” Bürger nicht an sie heran. Oder nur sehr umständlich.
Schwieriger Zugang zu Informationen
Ob in Städten, Kommunen, auf Landes- oder auf Bundesebene: Öffentliche Verwaltungen erheben eine große Menge von Daten. Verkehrsgutachten, Umweltuntersuchungen oder Tätigkeitsberichte stadteigener Unternehmen – die Palette ist vielfältig. Diese Informationen helfen der Politik, Sachverhalte einzuordnen und Entscheidungen zu treffen. Danach wandern sie in die Archive der Verwaltung. “Verschwendetes Potenzial”, kommentiert Herr Rack.

Ein Beispiel für die Arbeit von Herrn Rack: Welche Mannheimer Partei hat im Wahlkampf welche Worte verwendet? Wo gibt es inhaltliche Überschneidungen? Die interaktive Karte finden Sie hier. Foto: Oliver Rack.
In manchen Bundesländern gibt es Gesetze, die es den Bürgern – mit zahlreichen Ausnahmeregelungen – ermöglichen, Informationen abzufragen. Die Kosten, die dadurch entstehen, müssen die Bürger häufig selbst bezahlen. In anderen Bundesländern, wie etwa Baden-Württemberg, erhalten Bürger bisher gar keine Daten, es sei denn, sie sind am Verfahren beteiligt und haben einen Auskunftsanspruch.
Oliver Rack fordert eine pro-aktive Veröffentlichung von Verwaltungsdaten. Das heißt: Informationen müssen nicht erst angefragt und dann an jeden interessierten Bürger einzeln herausgegeben werden. Stattdessen veröffentlicht die Verwaltung ihre Daten automatisch auf einem zentralen Online-Portal mit Suchfunktion, sodass sie der gesamten Bevölkerung kostenfrei und ohne großen Aufwand zur Verfügung stehen.
Ärgerliche Rückständigkeit
Im Ausland ist das vielerorts schon Standard. Und auch in Hamburg gibt es seit Oktober 2014 ein sogenanntes Transparenzportal, das den Vorstellungen von Herr Rack sehr nahe kommt: “Das lässt eigentlich keine Wünsche mehr offen.”
In den vergangenen Monaten hatte das Transparenzportal jeweils mehr als eine Millionen Aufrufe – es gibt also ein großes Interesse seitens der Bevölkerung. Herr Rack wird ein bisschen missmutig. “Es wäre schon, wenn man schon überall so weit wäre”, sagt er:
Die Gesellschaft befindet sich mitten in einem digitalen Wandel – die Politik hinkt leider hinterher.
Er redet über diese Rückständigkeit, als hätte er sich eigentlich vorgenommen, sich nicht mehr darüber zu ärgern. Und trotzdem verschlechtert sich seine Laune immer wieder deutlich, wenn er darauf zu sprechen kommt. Dann runzelt er die Stirn, seine Stimme bekommt einen sarkastischen Unterton und seine Bemerkungen werden ein bisschen bissiger.
Das passt eigentlich kaum zu dem ansonsten sehr ruhigen und sachlichen Menschen. Es ist ein bisschen so, als wäre Herr Rack in Gedanken schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte weiter. In einem Zeitalter, in dem auch konservative Verwaltungsmenschen und die letzten Politiker die Vorteile und Möglichkeiten durch moderne Technologie erkannt haben werden. Und dann wird er wieder durch die Realität ausgebremst.
Keine Gegner, aber viele Bedenkenträger
Laut Herrn Rack gebe es in der Politik “eigentlich kaum Gegner” von Open Data, sondern “eine Menge Bedenkenträger”. Wie so oft sei es die Angst vor dem Unbekannten, die den Fortschritt verlangsamt. Man müsse diesen Leuten aufzeigen, wie viele Vorteile ihnen momentan entgehen und welche Möglichkeiten es gebe – und zwar am besten so früh wie möglich.

Open Data Rhein-Neckar organisiert regelmäßig Veranstaltungen, wie am vergangenen Wochenende den Open Data Day 2015 im Zeitraumexit. Foto: Oliver Rack.
Auch das ist ein Teil von Herrn Racks Arbeit: Er bietet Fortbildungen und Kurse für Schulklassen und Lehrer an, um technische Kompetenzen zu fördern und schon früh Intresse und Begeisterung für den Umgang mit Daten zu wecken.
Er hofft darauf, dass die Veränderungen spätestens mit den kommenden Generationen folgt. Die seien schließlich mit dem Internet groß geworden und sollten besser mit Technologie vertraut sein.
Utopische Visionen und vorsichtiger Optimismus
Langfristig träumt Herr Rack von einem zentralen Datenportal. Und zwar nicht nur für Deutschland – sondern für die ganze Welt. Er weiß selbst, dass das momentan noch “ein bisschen utopisch” ist. Trotzdem will er an der Vision festhalten.
Man dürfe vorsichtig optimistisch sein, findet Herr Rack: “Es geht zwar alles nur sehr langsam voran – aber es ist zumindest mal in Bewegung gekommen.” Auf Dauer würden sich jetzt bei den Vorreitern die Vorteile zeigen und schließlich auch der Rest der Welt nachziehen.
Bis man in Deutschland auf dem Stand ist, den Herr Rack sich vorstellt, werden wohl noch ein paar Jahre oder sogar Jahrzehnte vergehen müssen. Er sagt dazu: “Auf Bundesebene tut sich gerade Einiges, hier könnte sich bald viel verändern. Im Sommer 2013 haben die G8-Staaten eine Open-Data-Charta veröffentlicht und die Bundesregierung hat schon einen Plan entworfen, wie man diese umsetzen will. Aber bis auch das letzte Bundesland seine Daten pro-aktiv veröffentlicht, kann es noch eine Weile dauern – es gibt da ein paar konservative Spezialisten, die solche Modernisierungen nur sehr behutsam vorantreiben. Das sieht man ja zum Beispiel auch beim Informationsfreiheitsgesetz.”
“Vorteile überwiegen eindeutig”
Herr Rack erwähnt eine Studie der Oxford University, die deutlich zeige, wie groß der volkswirtschaftliche Gewinn durch offene Daten wäre. Aber nicht nur die Wirtschaft würde profitieren. Herr Rack hält es für wahrscheinlich, dass sich auch der Dialog zwischen Bürgern und Politik verbessern würde:
Wenn Subventionen oder Tätigkeitsberichte verschiedener Unternehmen transparent wären, könnte sich die Bevölkerung mündigere Meinungen bilden und einen höheren und sachlicheren Einfluss auf die Politik ausüben.
Außerdem könnte die Öffentlichkeit das Handeln der Politik besser überprüfen, was Korruption und “Gefälligkeiten” vorbeugen würde. Transparenz würde ganz eindeutig überwiegend Vorteile mit sich bringen – aber sie müsse auch ihre Grenzen haben: “Alle personenbezogenen Daten sind Privatsache und haben die Öffentlichkeit auch nichts anzugehen, das sollte selbstverständlich sein”, sagt Herr Rack. Gleiches gelte für Betriebsgeheimnisse und urheberrechtlich geschützte Informationen.
Es sei wichtig, hier sehr genaue Regelungen zu definieren. Ausnahmegründe dürften nicht dazu missbraucht werden, kritische Informationen unter Verschluss zu behalten: “Nicht jedes Unternehmen sollte einfach so alles zum Betriebsgeheimnis erklären dürfen.”
Erste Erfolge – Verlangen nach mehr
Oliver Rack hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie Datenpolitik aussehen sollte – und die versucht er an den Mann zu bringen. “Ich betreibe hauptsächlich Lobby-Arbeit und versuche verschiedene Politiker für Open Data zu gewinnen”, beschreibt er seinen Alltag. Außerdem organisiert er verschiedene Veranstaltungen und arbeitet viel über das Internet. Und seine Arbeit zeigt erste Wirkungen, vor allem in der Kommunalpolitik:
2013 hatte das Thema hier in der Region noch keiner auf dem Schirm. Inzwischen berät man in den Gemeinderäten von Mannheim und Ludwigshafen, ob man die Verwaltungsdaten nicht öffentlich machen sollte. Teilweise macht man es sogar schon.
In Mannheim hat sich inzwischen eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe zu Open Data gebildet, die von Gerd Armbruster aus dem Fachbereich für Informationstechnologie und IT-Infrastruktur geleitet wird. Laut Herrn Rack habe sich diese Arbeitsgruppe auf sein Werben hin gebildet.
Mannheim als Vorreiter?
Herr Armbruster trat vergangenes Wochenende beim Open Data Day 2015 als Redner auf und äußerte sich dort erstmals öffentlich zu den weiteren Plänen der Stadtverwaltung: Eine Entscheidung im Gemeinderat, ob in Mannheim ein Open-Data-Portal eingeführt werden soll, sei gegen Ende März vorgesehen. Zustimmung sei wahrscheinlich. Man dürfe zuversichtlich sein, dass die Stadt bis zum September diesen Jahres über ein Portal verfügen wird. Damit würde Mannheim – zumindest in Baden-Württemberg – eine Vorreiterrolle einnehmen.
Herr Rack weiß, dass das ein großer Erfolg ist und dass er alleine vieles bewirkt hat. Wirklich zufrieden wirkt er deswegen allerdings nicht. Es ist ganz klar: Er will noch viel mehr. Open Data ist für Herrn Rack mehr als ein Ziel – es ist ein Lebensinhalt, an dem er mit Hingabe arbeitet und für den er Vieles aufopfert.

Welche Kindernamen wurden in Mannheim 2014 wie häufig vergeben? Das interaktive Diagramm finden Sie hier. Auffällig: Bei den weiblichen Namen (linke Hälfte des Diagramms) sind die Namen Sophie und Marie mit deutlichem Abstand beliebter als alle anderen. Bei den männlichen Namen ist die Verteilung nicht ganz so ungleichmäßig.
Bis Herr Rack Open Data Rhein-Neckar gründete, hat er einige Stationen durchlaufen: Er war der erste Volontär beim Stadtmagazin Meier, später Ressortleiter von “Die Welt kompakt”, danach arbeitete er sieben Jahre als Fernsehjournalist, hauptsächlich für das Rhein-Neckar-Fernsehen.
Außerdem unterrichtete er als Dozent an den Universitäten Mannheims und Heidelbergs. Er verdiente sich auch mal etwas als DJ dazu. Damals auch schon Trendsetter:“Ich gehörte zu den ersten, die gegen Ende der 80-er Jahre House-Musik nach Mannheim gebracht haben”, erzählt er. Damals habe er oft im Milk!-Club aufgelegt.
“Bitte Ahnungslosigkeit eingestehen”
Das sei allerdings eher eine Freizeitbeschäftigung gewesen. “Für so etwas habe ich inzwischen keine Zeit mehr”, sagt Herr Rack: “Zu viel Arbeit.” Was Daten und Statistiken angeht, ist er ein Autodidakt. Er hat in diesen Bereichen nie ein Studium absolviert oder eine Fortbildung gemacht. Er sagt ganz offen:
Ich bin auch kein Experte für Daten – sondern eben für Open Data.
Man müsse seine “Ahnungslosigkeit immer ehrlich eingestehen”, findet Herr Rack. “Alles andere führt früher oder später zu größeren Problemen.” Das Entscheidende sei es zu wissen, wo man die Experten findet. Dann könne man Informationen zusammentragen, verdichten und verbreiten.
“Eine moderne Demokratie braucht Transparenz”
Die Arbeit, die Herr Rack leistet, ist zu sehr großen Teilen Idealismus. Er hat als Journalist weniger gearbeitet und deutlich mehr verdient. “Die Gesellschaft befindet sich im Wandel und da sind neue Formen für Kommunikation und Wissensvermittlung einfach notwendig.”
Es gebe “so viele Möglichkeiten, die uns die Technologie eröffnen würde, die aber einfach nicht genutzt werden”. An dieser Stelle hält Herr Rack kurz inne. Offenbar hat ihn wieder mal der Unmut über allgemeine Rückständigkeit eingeholt. Nach einer kurzen Pause verzieht er das Gesicht und schüttelt den Kopf. Dann sagt er:
Eine moderne Demokratie braucht Transparenz und Vernetzung. Die Vorteile sind doch ganz offensichtlich.
Service:
Open Data Rhein-Neckar im Internet
Open Data Rhein-Neckar bei Facebook