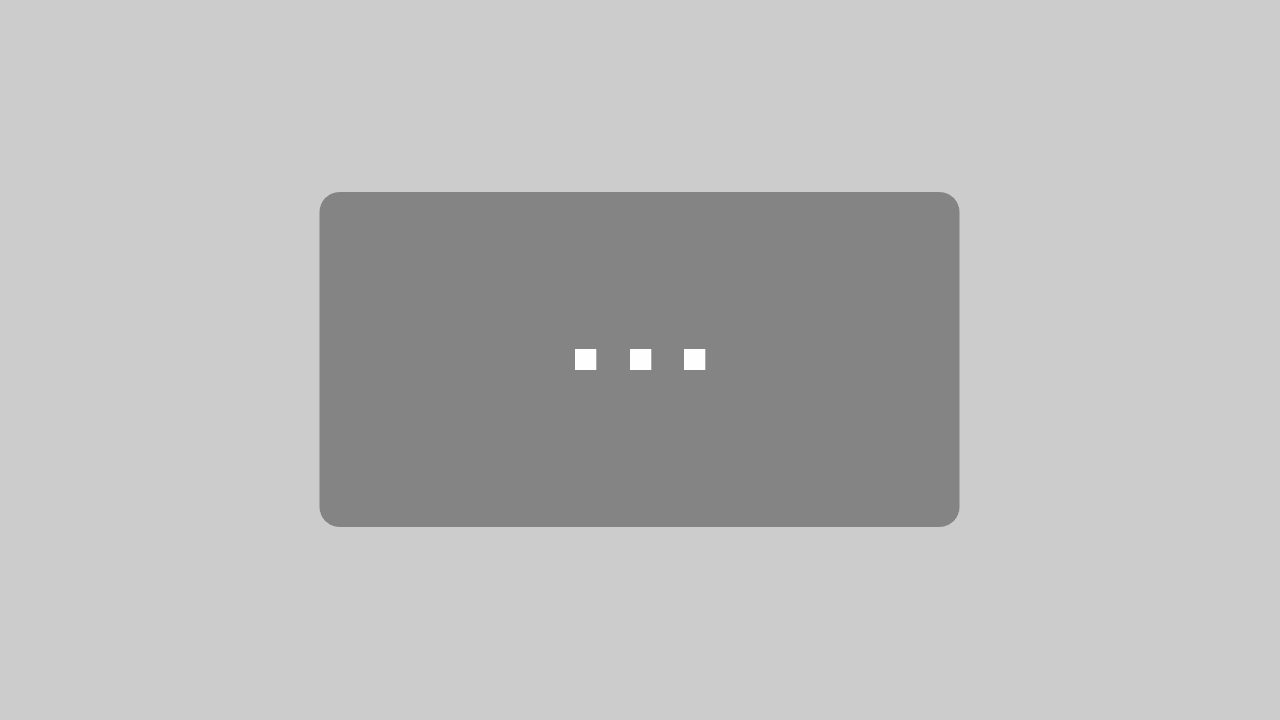Kreis Bergstraße/Rhein-Neckar, 03. Januar 2014. (red) Überhaupt keinen guten Start ins neue Jahr erleben die südhessischen Orte Birkenau und Rimbach sowie der komplette Odenwald. Laut der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist der Odenwald die Hölle auf Erden und Orte wie Birkenau, Mörlenbach und Rimbach sind die “scheußlichsten Orte der Welt”. Wer hier lebt, wird angeblich “im Kopf kaputt gemacht”. Einfach so. Weil man hier lebt. Die unausweichliche Folge laut der FAS-Redakteurin Antonia Baum: Drogen und Rauchen ab dem Alter von elf Jahren, Ladendiebstahl und eine die Persönlichkeit deformierende Depression.
Von Hardy Prothmann
Im Landratsamt Kreis Bergstraße läuft das email-Postfach voll. Eine ganze Region ist empört. Die Menschen in den südhessischen Odenwald-Gemeinden sind fassungslos und protestieren. Was haben sie getan, um derart kollektiv verachtet und verunglimpft zu werden? Was ist an ihren Orten so “pervers”, dass jemand mit schon fast pathologischer Wut sie so beschämt? Und wie kommt solch ein “Zeugs” (Text) in eine Zeitung, die sich sonst für die Bastion des Bildungsbürgertums hält? Wie reagiert man auf einen derartigen Hass auf Heimat und Heim? Auf Familie und Leben auf dem Land? Muss man sich das “gefallen” lassen, soll man reagieren oder lieber nicht?
Man sollte darauf reagieren. Denn die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) hat eine Auflage von knapp 350.000 Exemplaren. Zudem wurde der Artikel unter der zunächst nichtssagenden Überschrift “Dieses Stück Germany” auf faz.net veröffentlicht und beschädigt ohne Sinn und Verstand den Lebensraum von gut 30.000 Menschen. Einfach so. Ohne Anlass, ohne Fakten – nur weil eine offensichtlich zutiefst traumatisierte Nachwuchsjournalistin und eine zutiefst verantwortungslose Redaktion ihrer gleichsam egozentrierten Hybris freien Auslauf lassen.
Auf Tour oder Tourette?
Vielleicht leidet die Autorin Antonia B. schlicht und ergreifend am Tourette-Syndrom und muss ab und zu einfach laut Scheiße schreiben, weil sie einfach krank ist und nicht anders kann. Hinweise gibt es genug. Aber dann wäre sie so eine Art Jonathan Meese der jungen Literatur. Ästhetisch eher eklig, also noch ekliger, als sie viele Sachen eklig findet und am ekligsten wäre ja, wenn sie nicht nur eklig wäre, sondern auch so aussehen würde. Wie profan. Deswegen sieht sie adrett aus und gibt sich mädchenhaft. Auch, wenn sie bald 30 Jahre alt wird. Sie hat so eine Art Lizenz der Dauer-Abiturientin. Davon gibt es in Berlin viele, die nicht erwachsen werden wollen. Die meisten sind aber wirklich dümmer als die Dummheit erlaubt und Antonia B. hat einen geheimen Traum. Dazu mehr am Ende des Textes.
Von Selbsthass, Frust und Wut handelt ihr 2011 erschienener Debütroman “Vollkommen leblos, bestenfalls tot”. Hier ist es die Großstadt, die Antonia B. ähnlich hoffnungslos, zerstörerisch und krank machend bezeichnet wie den ländlichen Raum des Odenwalds. In der Zeit wird das Buch so besprochen:
Alkoholexzesse, Drogenabstürze, Amok-Fantasien und schließlich am Ende der Todeswunsch: »Oh Gott, ich lebe in einer Welt voll Scheiße.«
Natürlich muss es nicht zwangsläufig so sein, dass Antonia B. selbst in einer Welt voll Scheiße lebt. Sie ist ja nur die Autorin einer fiktiven Ich-Erzählerin und eine durchaus attraktive junge Frau mit mädchenhaftem Sprechduktus bei gleichzeitig gewollt lasziv-lächelndem Augenaufschlag und einem leichten Lispeln.
Was ist real, was fiktiv?
Hermeneutisch betrachtet, darf man aber fragen, inwieweit die Autorin des Textes auch die Autorin im Text ist. Und da die reale Motivwelt der Feuilleton-Redakteurin Antonia B. in der porträtierenden Schilderung ihrer traumatischen Kindheit überraschend ähnlich der der verfiktiven Protagonistin in der Großstadt ist, wird das sogar wahrscheinlich. Autorin wie Protagonistin flüchten vom Land in die Großstadt. Die Autorin beginnt mit elf Jahren zu rauchen und “zu kiffen, bis man nichts mehr sah, und zu klauen, um sich irgendwie zu unterhalten.”
Literaturwissenschaftlich betrachtet, ist der aktuelle Artikel im Feuilleton der FAS sehr aufschlussreich. Denn er lässt offensichtliche Schlüsse zwischen der “realen” Erlebniswelt der Autorin und ihrer durch und durch kaputten, verächtlichen und hassenden Romanfigur zu. Ist die Ich-Erzählerin im Roman am Ende nur der Spiegel in eine durch Kiffen verrückte Psyche einer frustrierten FAS-Autorin, die einfach dort landen musste, weil die Klapse zu gewöhnlich gewesen wäre?
Also landflüchtet Antonia Baums Heldin, so wie jedes Post-Abitur-Mittelstandskind, getrieben von Sehnsüchten und der Hoffnung auf Besserung der Gesamtsituation, in die Großstadt. (taz, 15.10.2011)
Die Handlung ist schnell skizziert: Die Icherzählerin, ein junges Mädchen, will so schnell wie möglich weg von zu Hause. Sie erträgt ihren Vater nicht, weil der nur an sein Ego denkt und ihre Mutter dafür rücksichtslos ausnutzt. Und sie erträgt ihre Mutter nicht, weil diese sich das viel zu lange gefallen ließ. (Zeit, 17.11.2011)
In der Beschreibung der realen Erfahrungswelt von Antonia B. liest sich das so:
Die Familienoberhäupter waren Männer, die Frauen meistens zu Hause, die Männer schrien die Frauen an, wenn sie selbst versagt hatten, die Frauen ließen sich von ihren Männern anschreien, und beide, Männer wie Frauen, wollten in der Nachbarschaft einen gepflegten Eindruck machen.
Muss man davon ausgehen, dass Antonia B. aus einer kaputten Familie kommt? Außen eine scheinheilige Fassade, innen die Hölle? Ihr Vater ein hochgradiges Arschloch, ihre Mutter eine dumme Landkuh? Dazu nix los im im Dorf. Im Odenwald. Aus Sicht einer gelangweilten narzistisch-pubertierenden Göre ganz sicher der falscheste aller falschen Plätze, um als herausragendes Schriftstellerinnen-Talent entdeckt zu werden. Nur Dummheit. Nichts als degenerierte Dummheit um diesen eigenen verstrahlten Geist herum.
Die innere Hölle der Antonia B.
Und wie bitter musste die Erfahrung sein, endlich als “Odenwaldinhaftierte” dieser “Odenwaldhölle” entkommen zu sein, um in der Betonhölle der Großstadt festzustellen, dass hier auch alles einfach nur erbarmungslos scheiße ist. Im Odenwald gibt’s Bäume, in Berlin viel Beton. Planton erzählte gleichnishaft von der Höhle, deren Hölle Antonia B., wenn auch geblendet vom Licht entkommen zu sein scheint. Doch sie spürt, dass die Höhle, die der Frucht, die sich in ihren Leib einnisten will, schicksalshaft nicht entkommen kann. Und Antonia B. wehrt sich. Indem sie alles beschimpft. Die Logik ist einfach: Es muss mehr als zwei Wege geben. Mehr als Licht und Schatten. Und selbst wenn es die Erkenntnis sein soll, dass es eben doch nur Licht oder Schatten gibt und beides Scheiße ist. Damit hebt man sich immer noch über die, die sich für eins von beiden entscheiden.
Sie schreibt halt gerne über Leichen im Keller, verzehrt sie gleichsam und erklärt das hinterher als sinnlos. So geht halt nekrophiler Neo-Nihilismus. Ganz sicher kann die Antonio B. schreiben. Man kann ihr sicher nicht vorwerfen, dass sie das nicht kann. Ob man das gut findet oder nicht, steht nicht auf ihrem Blatt.
Aber man kann ihr sehr wohl vorwerfen, wie achtungslos sie dieses Schreiben benutzt. Denkt man Ihr Schreiben weiter und wendete es konsequent auf sie an, so bleibt allerdings nichts als Sinnlosigkeit. Das kann auch Selbstschutz im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung sein. Solange sie ihrem Körper in Abrede stellt, dass in ihr ein lebenshungriges Wesen wachsen kann, wird es auch nicht wachsen, ob verhindert oder abgetrieben.
Nicht schwanger ist wenigstens leblos
“Vollkommen leblos” ist eine kontradiktische Metapher. Vollkommenheit ist ein Los ohne jedes Leben. Nicht menschlich. Und “bestenfalls tot” eine Umschreibung von “über die Toten nichts als Gutes”. Vielleicht ist es aber auch ganz simpel die Erleichterung einer Angst vor einem Leben, das, solange man es nicht will, einfach tot diagnostiziert werden soll. Wie traurig.
Im Wald gibt es Vegetationsstufen, in der Großstadt stapeln sich Stockwerke auf Stockwerke. Hier wie da versuchen Menschen ihrem jeweiligen Leben einen Sinn zu geben. Eine postpubertäre, sprachtalentierte Göre hat ein “Ich weiß, dass ich nichts weiß” irgendwie in den falschen Hals bekommen und will einfach mehr wissen als andere. Und wenn schmerzhaft nur so geht, alles Wissen und Sein als bedeutungslos und damit dumm, dümmer, am dümmsten zu charakterisieren. Inklusive ihrer selbst, die das aber zumindest so gemeinschaftlich reflektiert, als sie zwar weiß, wie dumm alles Dumme ist, aber auch keinen Ausweg kennt.
Das ist ihr Thema. Sie selbst. Und ob sie nun an Tourette leidet oder sonst einen Hau abhabt oder einfach nur den kalkulierten Skandal als Eigenmarketing nutzt (“außen süß und innen böse”).
Wer weiß? Die Feuchtgebiete hat Charlotte Roche schon besetzt. Irgendwas mit Nazis ist voll Panne und wenn man lustlos ist – warum nicht das lustlose “Sinnbewältigungsproblem” zum Erkennungsmerkmal bis zum Exzess stilisieren? Dazu schreibt die fast 30-Jährige “über absurdeste Orte”, “abwegigste Ortschaften” und “perverse Kleinstädte” – und alle sind gleich. Alles ist eklig und von allem wird ihr schlecht. Sie, also die Protagonistin, leidet unter Menschheit als Tötungsdelikt und die Autorin fühlte sich im Odenwald zum Tode verurteilt.
Mit großer Wahrscheinlichkeit, bist Du hier falsch,
lässt Antonia B. ihre Romanheldin sagen. Mit sehr großer Sicherheit ist der Artikel der Autorin über den Odenwald einfach nur ein Umschrieb ihres Debüt-Romas.
Und ärgern darf man sich über Antonia B. und die FAS dann, wenn man den Text ernst nimmt. Einen Sinn darin sucht und Antonia B. damit auf den Leim geht. Es gibt keinen Sinn und jeder, der den sucht, ist ein Depp.
Verstehste? Reingelegt. Idiot. (Ehrlich? Ich bin auch zunächst drauf reingefallen.) Es handelt sich nicht um eine journalistische Arbeit mit irgendwelcher Mühe, die Dinge zu verstehen und zu erklären. Der Text ist ein Selbstplagiat. Ein Abklatsch, um sich an ein paar Odenwäldern zu rächen, denen sie noch eins reinwürgen wollte. Sich selbst inbegriffen. Kopf-Gewichse am Schreibtisch beim Betrachtern der schlanken Finger, die nie Arbeit gesehen haben, dafür aber gut lackiert sind. Leblos, aber schön. Imagination. So wie geklautes L’Oréal.
Antonia B. und der Tag der offenen Tür
Geht man darauf ein, verschafft man dem trostlosen Gemüt der Antonia B. kurzfristig ein wenig Leidensfreude. Denn dann bestätigt sich ja, wie sehr dumm die sehr Dummen im Odenwald sind. Genau deshalb sollte man auf sie reagieren und zwar anders, als sie es erwartet. Die Empörung ist von ihr berechnet. Sie langweilt das, hält es für dumm. Typische Verachtungsschnittmenge.
Genau deshalb sollte man ihr Grüße aus der schönen Heimat schicken. Möglichst in Tracht. Mit glückseligem Lächeln und einer Einladung zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr, sowohl in Birkenau, als auch in Mörlenbach, als auch in Rimbach.
Denn mit einiger Wahrscheinlichkeit kann man davon ausgehen, dass Antonia B. sich seit Drucklegung von “Vollkommen leblos, bestenfalls tot” irgendwie im Kreis dreht und nicht vorankommt. Sie ist eine Gefangene ihres eigenen Sinnbewältigungsproblems.
Vermutlich dauert dieser Zustand auch schon länger an als die Drucklegung des Buches. Vermutlich ist der Druck arg groß und das Ablassventil in unerreichbarer Ferne:
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich, hätte es im Odenwald nicht einen vernünftigen Mann gegeben, meinen vom Odenwald ohnehin schon verwüsteten Kopf mutwillig vollends verwüstet hätte, vielleicht wäre ich jetzt tot oder Drogendealer, oder ich hätte aufgegeben, wäre im Odenwald geblieben und längst mehrfache Großmutter. Der Mann, der mich vor alldem bewahrt hat, war mein Deutschlehrer, und seinetwegen setzte ich mich an manchen Tagen gerne in die Weschnitztalbahn, um in die Schule zu fahren, wo er über Bücher sprach, in denen man, selbst im Odenwald, zumindest zeitweise, zu Hause sein konnte, die einem aber umso deutlicher machten, warum man da dringend weg muss, aus dem Odenwald, aus allem, raus..
Vielleicht hätte sie einfach ihren Deutschlehrer heiraten sollen, den sie im FAS-Artikel am Ende fast zärtlich umschwärmend liebkost, der aber vermutlich nur ihren Geist, aber niemals ihr Fleisch berührt hat. War dieser Deutschlehrer ihre erste große, aber heimliche Liebe? Ist sie seitdem auf der Suche nach ihm – in vollem Bewusstsein, dass sie ihn in der Vergangenheit in ihrer verfluchten Heimat nicht finden kann und auch in der oder den neuen Welten nicht?
Man muss nicht Literaturgeschichte studiert haben, um zu wissen, dass enttäuschte Lieben ein lebenslanger Quell der freudlosen Wüte sein können. Insbesondere dann, wenn diese nur überwunden werden können, indem man genauso spießig wird wie das Leben, das man überwinden will. Pubertierende ohne Verstand halten das immer schon für pervers.
Schmerz. Sehnsucht.
Das kann man real oder fiktiv so viel Abtreiben wie man will. Es bleibt der Schmerz der Sehnsucht. Vermutlich ganz banal nach Liebe. Oder Liebensfähigkeit. Mit all den Fassaden, die mal mehr, mal weniger, aber immer dazugehören.
Die alten Griechen nannten das ein Dilemma. Und modern lässt sich das Leiden der jungen B. vielleicht so beschreiben: Antonia B. hat persönlich den Odenwald verlassen, aber der Odenwald niemals die Person Antonia B. Ganz egal, wo sie hingeht.
Was bleibt als Erkenntnis? Man entkommt seinem Schicksal nicht. Egal, was man tut.
Antonia B. kann sich noch so sehr an “Menschfressern” ergötzen und sich noch so sehr im Nichts ergehen. Sie ist zwar in Borken (Westfalen) geboren, aber die Zeit ihrer heranwachsenden Erkenntnis hat sie im Odenwald erlebt. Sie kann das alles zunichte machen. Schlecht schreiben wie es schlechter nicht mehr geht. Den Geruch von Kochkäse und die B38 und die Weschnitztalbahn wird sie – egal, was sie tut – nie mehr los.
Sie wird, und das ist dramatisch, auf ewig von diesen prägenden Erfahrungen traumatisiert sein.
Einen Ausweg aus dem Labyrinth kann jeder finden. Ich empfehle der jungen Frau den Mythos von Sisyphos von Albert Camus. Diese Welt ist absurd. Wenn man das verstanden hat, kann man auch wieder ein wenig Lachen. Zumindest in den Pausen.
Und vielleicht sogar, wenn man ein Baby statt einem “Vollkommen leblos, bestenfalls tot” in Händen hält.
Bisweilen versucht sie sich noch als Feuilletonistin. Und die verantwortlichen Redakteure geben ihr den Raum, um ihre Exzesse ausleben zu können.
So ist halt Berlin. Da hocken Schwaben und Odenwälder aufeinander, spielen Metropole und kommen nicht aus ihren ländlichen Strampelanzügen heraus. Egal, wie unglücklich man über vollgepisste Windeln ist und sich nach Mama sehnt, die aber irgendwie auch des Teufels sein muss, weil man nie gefragt worden ist, wieso man in diese sinnlose Welt gesetzt wurde.
Das ist einfach ungerecht. Antonia B. hat sich gerächt. An allem.
Und sie weiß – immerhin das ein Schritt in Richtung Erwachsensein – dass der Odenwald und Birkenau mit seinen Sonnenuhren auch die Sonnenallee in Neukölln hätte sein können. Aber da wäre sie vermutlich nicht so behütet aufgewachsen. Da hätte sie mit großer Wahrscheinlichkeit selbst auf die Fresse gekriegt, statt jetzt anderen auf die Fresse zu hauen. Einfach so. Weil ihr nix Besseres einfällt.
Weiterführende Informationen
Lesung aus “Vollkommen leblos, bestenfalls tot” – knapp 17 Minuten, die als Selbstplagiat den Artikel in der FAS verständlicher machen. (Wer sich wirklich interessiert, guck das – können wir nicht einbinden, sondern nur verlinken.)
Oder das:
Zeit online: “Eine Welt voll Scheiße”
Uni Duisburg: Die Autorin Antonia Baum
Bachmann-Preis: Jury-Diskussion
Perlentaucher: Vollkommen leblos, bestensfalls tot